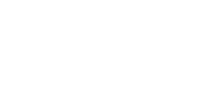
|
AT-OeStA/HHStA RHR Judicialia APA 108-1 Minden Hochstift, Bischof contra Lippe, Simon [VI.] Graf zur; Auseinandersetzung wegen Lehenguts Ulenburg; Erlaß kaiserlicher Mandate; Einsetzung kaiserlicher Kommissionen, 1581-1610 (Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File))
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/HHStA RHR Judicialia APA 108-1 |
| Titel: | Minden Hochstift, Bischof contra Lippe, Simon [VI.] Graf zur; Auseinandersetzung wegen Lehenguts Ulenburg; Erlaß kaiserlicher Mandate; Einsetzung kaiserlicher Kommissionen |
| Entstehungszeitraum: | 1581 - 1610 |
| Darin: | Rechnungsbücher der Ulenburg (Einkünfte, Dienstleistungen, zugehörige Güter; z. T. Auszüge) 1583-1593, fol. 31r-479r; Bericht des Bischofs von Paderborn als kaiserlicher Kommissar (Rechnungsbücher der Ulenburg), s.d. [1598-1599], fol. 1r-491v; Notariatsinstrument (Zustellung des kaiserlichen Kompulsorials) 1595 05 22, fol. 508rv (Ausfertigung); |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Kläger/Antragsteller/Betreff: | Minden Hochstift, Bischof (1); Lippe, Simon [VI.] Graf zur, Reichshofrat (2) |
| Beklagter/Antragsgegner: | Lippe, Simon [VI.] Graf zur (1); Mulert, Ernst, Hauptmann, aus Lingen (Ems) (2); Minden Hochstift, Bischof (3); Minden Hochstift, Domdekan, -senior und -kapitel (4); Quernheim, Friedrich Philipp, Eckbrecht und Hermann von, Brüder (5); Münchhausen, Hilmar, Christoph, Elisabeth und Margarethe von (6) |
| RHR-Agenten: | Kläger (1), Beklagte (4): Holtz, Joachim vom (1599); Kläger (2): Sternberg, Johann (1607) |
| Gegenstand - Beschreibung: | Kläger (1) erhebt Vorwürfe gegen zwei inzwischen verstorbene Adelige des Stifts Minden. Christoph von Wirsberg habe ohne Zustimmung des Klägers (1) als Lehensherr und ungeachtet eines vor Kläger (1) und dem Reichskammergericht anhängigen Verfahrens um die Lehensfolge ein Lehengut des Stifts Minden um 35.000 Gulden an Beklagten (2) verkauft. Nach dem Tod Wirsbergs versuche Beklagter (2), sich gewaltsam in den Besitz des Guts zu setzen. Hilmar von Quernheim habe eine Reihe von Rechten (Jurisdiktion, Steuererhebung), die er als Inhaber des ihm verpfändeten bischöflich-mindischen Amts Reineberg ausgeübt habe, auch nach der Wiedereinlösung des Amts durch Kläger (1) nicht zurückgegeben. Statt dessen habe er sie von seinem in der Zeit der Verpfändung Reinebergs vom Bauernhof zum Adelssitz ausgebauten Gut Ulenburg aus weiter ausgeübt. Als Kläger (1) diese Praxis nicht habe dulden wollen, habe Beklagter (1) als Lehensherr Quernheims, der das Eigentum an dem Gut Ulenburg beanspruche, eine Klage gegen Kläger (1) vor dem RKG angestrengt, wo der Streit um die Ulenburg rechtshängig geworden sei. Nach dem Tod Hilmars von Quernheim seien Gerüchte entstanden, Beklagter (1) wolle das Gut gewaltsam in seinen Besitz bringen. Kläger (1) beantragt ein kaiserliches Mandat gegen Beklagten (1), nicht gewaltsam gegen ihn vorzugehen und d |
| as Verfahren vor dem RKG weiterzuverfolgen. Außerdem bittet Kläger (1) um ein kaiserliches Schreiben an Wilhelm [V.] Herzog von Jülich[-Kleve-Berg] als Oberst des Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreises, das Stift Minden vor gewaltsamen Übergriffen zu schützen. Beklagter (1) leugnet, Pläne für ein bewaffnetes Vorgehen gegen Kläger (1) verfolgt zu haben. Er könne beweisen, daß die Ulenburg Eigentum der Grafen von Lippe und nach dem Tod Hilmars von Quernheim ohne männliche Erben an das Haus Lippe zurückgefallen sei. Beklagter (1), jetzt Kläger (2), erhebt Klage gegen Kläger (1), jetzt Beklagter (3), sowie gegen Beklagte (4). Beide hätten die Inbesitznahme der Ulenburg durch Kläger (2) vereitelt, indem sie das Gut von Bewaffneten hätten besetzen lassen. Darüber hinaus hinderten sie die Amtleute des Klägers (2) daran, die zum Gut gehörenden Rechte (Holzschlag, Jurisdiktion) wahrzunehmen. Kläger (2) bittet um einen kaiserlichen Befehl, später um ein kaiserliches Mandat gegen Beklagte (3) und (4), die Ulenburg an ihn zu übergeben und etwaige Ansprüche auf dem Rechtsweg bzw. vor einer zu diesem Zweck eingesetzten kaiserlichen Kommission vorzubringen. Er erklärt seine Bereitschaft, Beklagten (3) und (4) Kaution zu leisten und sie damit für den Fall abzusichern, daß sich in einem späteren Rechtsverfahren einige ihrer |
| Ansprüche als gerechtfertigt erweisen sollten. Später beantragt Kläger (2) die Verurteilung der Beklagten (3) und (4) zu der in dem kaiserlichen Rückgabemandat für den Fall des Zuwiderhandelns vorgesehenen Strafzahlung und verschärfte Rückgabebefehle. Beklagter (3) behauptet, das Gut Ulenburg nicht militärisch besetzt, sondern einer Sequesterverwaltung unterstellt zu haben. Dazu sei er als Landesherr verpflichtet gewesen, da die Rechte auf die Ulenburg zwischen Kläger (2) und Beklagten (5), den Agnaten Hilmars von Quernheim, strittig gewesen seien. Außerdem beanspruche Kläger (2) dieselben Rechte, die bereits Hilmar von Quernheim zu Unrecht ausgeübt habe. Der Streit um diese Rechte sei am RKG rechtshängig. Beklagte (3) und (4) bitten, das Rückgabemandat zu kassieren, Kläger (2) mit seinen Ansuchen ab- bzw. an das RKG zu weisen und zu erklären, daß Kläger (2) über keine Holzschlagsrechte in der Holzgrafschaft Scheidermark verfüge. 1593 wird die Ulenburg an Beauftragte des Klägers (2) übergeben. Anschließend beschuldigt Kläger (2) Beklagte (3) und (4), durch die Rückgabe des Guts dem kaiserlichen Mandat nur unvollständig (Beklagter (3)) bzw. gar nicht (Beklagte (4)) nachgekommen zu sein (Schäden an den Gebäuden, Nichtabtretung von Rechten, keine Leistung von Schadensersatz). Kläger (2) erklärt sich bereit, vor ei |
| ner kaiserlichen Kommission Beweise zum Zustand der Ulenburg zur Zeit Hilmars von Quernheim und den zugehörigen Rechten vorzulegen. Beklagte (3) und (4) leugnen, dem Mandatsbefehl nicht in vollem Umfang nachgekommen zu sein. Beklagte (4) bitten, eine kaiserliche Kommission einzusetzen, vor der sie die Behauptungen des Klägers (2) mit geeigneten Beweismitteln widerlegen könnten. Darüber hinaus beantragen sie, Heinrich Julius Herzog von Braunschweig[-Wolfenbüttel] und Ernst Graf von Holstein[-Schauenburg], die Erben früherer Mindener Bischöfe, laden zu lassen, da einige der Forderungen des Klägers (2) Rechte beträfen, die im Besitz der Häuser Braunschweig[-Wolfenbüttel] bzw. Holstein-Schauenburg seien. Nach dem Abschluß der Beweisaufnahmen vor beiden Kommissionen bittet Kläger (2) um ein Urteil. Kläger (2) wendet sich auch an die Reichshofräte, Beklagte (3) und (4) auch an den Reichsvizekanzler Jakob Kurz [von Senftenau], den Präsidenten und Vizepräsidenten des RHR sowie an die Reichshofräte. Im Verlauf des Verfahrens beschuldigt Kläger (2) Beklagte (3) und (4) mehrfach, die ihm zustehenden Rechte durch die Verhaftung und Bestrafung von Untertanen der Ulenburg verletzt zu haben. In diesem Zusammenhang bittet er jeweils um spezielle kaiserliche Befehle bzw. Mandate, die Untertanen freizulassen und erpreßte Strafzah |
| lungen zu erstatten. Gegen Beklagte (5) erhebt Kläger (2) Klage, da sie die Zahlung eines Zolls verweigerten, der stets an die Grafen von der Lippe abgeführt worden sei. Beklagte (6) hätten ein Verfahren wegen der umstrittenen Holzschlagsrechte in der Scheidermark vor Beklagtem (3) angestrengt, obwohl diese Rechte Gegenstand des laufenden Prozesses seien. Kläger (2) bittet, Beklagten (6) zu laden und Beklagtem (3) die Fortführung des Verfahrens zu verbieten. In einigen seiner Eingaben spricht Kläger (2) auch andere Materien an. Er bittet, die mit den Landständen der Grafschaft Lippe ausgehandelte Hofgerichtsordnung, die Belehnung des Klägers (2) mit der Grafschaft Lippe durch den Bischof von Paderborn und [Wilhelm IV.] Landgraf von Hessen[-Kassel], eine Primogeniturregelung für die Grafschaft Lippe sowie ein Münzprivileg der Grafen von der Lippe zu bestätigen. Darüber hinaus beantragt er, das Appellationsprivileg der Grafen dahingehend abzuändern, daß in Zukunft gegen Urteile der gräflichen Gerichte erst ab einem Streitwert von mehr als 400 Goldgulden appelliert werden dürfe. Kläger (2) bittet auch, 6.000 Gulden Unkosten zu erstatten, die ihm als Gesandter des Kaisers in die Niederlande entstanden seien. Schließlich beantragt Kläger (2), in seiner Auseinandersetzung mit Philipp Ernst Graf von Gleichen um zwei D |
| örfer sowie wegen eines Streits mit den Brüdern Adolf [XI.] und Ernst Grafen von [Holstein-]Schauenburg um die Aufteilung eines Erbes zwei kaiserliche Kommissionen einzusetzen. |
| Entscheidungen: | Kaiserlicher Befehl an Beklagten (1), nicht gewaltsam gegen Kläger (1) vorzugehen und etwaige Ansprüche nur auf dem Rechtsweg zu verfolgen 1581 04 10, fol. 523r-526v (beglaubigte Abschrift); Zustellung der Stellungnahme der Beklagten (4) zu Einwänden des Klägers (2) an Kläger (2) 1595 04 22, fol. 559r-560v; Kaiserlicher Befehl an Beklagte (4), sich vor Bischof von Paderborn als kaiserlichem Kommissar einzulassen und eigenen Kommissar für die Beweisaufnahme zu benennen 1595 04 22, fol. 557r-558v; Kaiserliches Promotorial an RKG (Zitationsprozeß Beklagter (5) contra Kläger (2) wegen Lehensfolge in der Ulenburg) 1595 07 15, fol. 553r-556v; Kaiserliches Schreiben an Kläger (2) (Weiterbetreiben des von Beklagten (5) angestrengten Verfahrens vor RKG) 1595 07 16, fol. 549r-552v; Kaiserlicher Befehl an Bischof von Paderborn als kaiserlicher Kommissar, Kommission ungeachtet der Appellation der Beklagten (4) gemäß kaiserlichem Kompulsorial fortzusetzen 1596 02 14, fol. 2v-5r; |
| Bemerkungen: | Weitere Alten K. 105, K. 106, K. 107, K. 109 |
| Umfang: | fol. 1-566 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1640 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4297172 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |
|