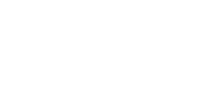
|
AT-OeStA/HHStA RHR Judicialia Antiqua 121-1 Regularkanoniker des Ordens vom Heiligen Kreuz contra Lippe und Konsorten; Streit um die Hälfte der Güter des ehemaligen Kreuzherrenklosters Falkenhagen in der Grafschaft Schwalenberg, 1597-1717 (Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File))
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/HHStA RHR Judicialia Antiqua 121-1 |
| Titel: | Regularkanoniker des Ordens vom Heiligen Kreuz contra Lippe und Konsorten; Streit um die Hälfte der Güter des ehemaligen Kreuzherrenklosters Falkenhagen in der Grafschaft Schwalenberg |
| Entstehungszeitraum: | 1597 - 1717 |
| Frühere Signaturen: | Fasz. 123, Nr. 1 |
| Darin: | Kommissionsberichte des Kurfürsten Johann von Köln: 1625 03 29 (Ausf.), fol. 15r-16v; 1627 01 01 (Ausf.), fol. 21r-22v; Akten der 1624 bis 1627 in Paderborn tätigen Kommission, fol. 23r-159v; Bulle Papst Pauls V., Bestätigung der Übertragung des ehemaligen Klosterguts in Falkenhagen an das Jesuitenkolleg in Paderborn, 1607 07 18 (Abschr.), fol. 59r-65v; Verzeichnis der Urkunden und Akten, die sich 1696 12 04/14 in der “Falckenhagischen Kiste” in Schwalenberg befunden haben (88 Nummern, ab 1213), fol. 133r-140v; Species facti [1649], fol. 162r-163r; Kommissionsbericht des Herzogs August II. von Braunschweig-Wolfenbüttel, 1649 07/08 30/09, fol. 195r-203v; Fürbittschreiben für die Jesuiten von: Kurfürst Maximilian Heinrich von Köln, 1651 10 06 (Ausf.), fol. 234rv; Gesuche der in Regensburg versammelten evangelischen Reichstagstände, den Streit vor einer Reichsdeputation entscheiden zu lassen und die von den Jesuiten erwirkten Kommissionen aufzuheben: 1675 01 03 (Ausf.), fol. 402r-405v, ferner (Abschr.), fol. 458r-461v; 1678 04 26 (Ausf.), fol. 423r-430v, ferner (Abschr.), fol. 462r-467r; 1699 07 25 (Ausf.), fol. 454r-457v, ferner (Abschr.), fol. 519r-521v; 1700 04 10 (Ausf.), fol. 515r-518v; 1702 02 09 (Ausf.), fol. 592r-601v; 1703 07 07 (Ausf.), fol. 615r-622v Protestschreiben der kreisausschreibenden Fürsten des Niedersächsischen Kreises zugunsten der Grafen, 1699 10 03 (Ausf.), fol. 471r-476v; “Gründliche auß den RhR. Actis gezogene Informatio” an den Bischof von Münster und an Kurpfalz über den Streitfall, bei dem die Jesuiten im Recht seien, undat. [1701?], fol. 574r-587v; Fürbittschreiben der auf dem Reichstag versammelten katholischen Stände für die Jesuiten, 1703 04 14 (Ausf.), fol. 602r-612v; Berechnung des Wertes der von den Grafen zu Lippe 1623 bis 1629 zurückgehaltenen Hälfte des Klosters Falkenhangen einschließlich der Gerichtskosten (ca. 250.000 Reichstaler), 1629, fol. 682r-686v; Notariatsinstrumente. |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Kläger/Antragsteller/Betreff: | Regularkanoniker des Ordens vom Heiligen Kreuz (Kreuzherren), General Georg Constantini; Paderborn, Jesuitenkolleg, Rektor Anton Stratius, für dieses: Kedd, Jodokus, Provinzial der Jesuitenprovinz Niederrhein; Tonnemann, Vitus, Jesuit; |
| Beklagter/Antragsgegner: | Lippe, Graf Simon VI. zur; Lippe-Detmold, Grafen Simon VII., Hermann Adolf, Simon Heinrich, Friedrich Adolf zur; Niedersächsischer Kreis, ausschreibende Fürsten; Corpus Evangelicum am Regensburger Reichstag; Kurfürsten von Brandenburg bzw. König in Preussen |
| RHR-Agenten: | Grafen: Graas, Johann (1654) Jesuiten: Mayer, Franz (1661); Mayersheim, Franz von (1674); Lauterburg, Johann Jakob Albrecht von (1698); Klerff, Friedrich von (1701) |
| Gegenstand - Beschreibung: | Den Ausgangspunkt des sich über ca. einhundert Jahre hinziehenden Streits bildet die in zahlreichen Parteienschriften und Kommissionssachen erwähnte und demnach 1596 10 14 erfolgte Teilung der Güter des zuvor säkukarisierten Schwalenberger Klosters zwischen Bischof Dietrich IV. von Paderborn und Graf Simon VI. zur Lippe. Obwohl der General der Kreuzherren dagegen protestiert und bei Papst und Kaiser und Mandate ausgewirkt habe, habe Bischof Dietrich IV. mit wiederum päpstlichem Konsens seine Hälfte zur Finanzierung seines Jesuitenkollegs in Paderborn verwandt. Die lippische Hälfte sei 1610 bei der Erbteilung zwischen den Söhnen Simons VI. zur Lippe, Simon [VII. zur Lippe-Detmold], Otto [von Lippe-Brake], Hermann [zur Lippe-Schwalenberg] und Philipp [I. von Schaumburg-Lippe], an Hermann gelangt, der Domkanoniker in Köln gewesen sei. Dieser habe seine Hälfte 1621 “jure legato” ebenfalls den Paderborner Jesuiten überlassen. Als die Jesuiten diese Hälfte von Simon VII. eingefordert hätten, habe dieser vorgebracht, Hermann habe diese Güter nur “usufructuarie” als eine Apanage auf Lebenszeit besessen, nicht aber eigentümlich. Er sei deshalb nicht berechtigt gewesen, sie zu vererben. Die Jesuiten wenden sich daraufhin an den Reichshofrat, der den Kurfürst von Köln mit einer Kommission beauftragt. 1626 entscheidet der Reichshofrat zugunsten der Jesuiten, die entweder 1626 oder 1629, nachdem die Kreuzherren endgültig auf ihre Ansprüche verzichtet haben, wirklich in den Besitz der ehemals lippischen Hälfte der Klostergüter eingesetzt werden. 1649 führen die Jesuiten aus, die Grafen hätten eine Kommission auf die ausschreibenden Fürsten des Niedersächsischen Kreises erwirkt, die ihnen 1649 08 12 jene Hälfte des Klosters aus dem lippischen Erbe, die ihnen 1626 per Reichshofratsurteil zugesprochen worden sei, wieder entzogen habe, und zwar ohne Rücksicht auf die in dieser Sache bereits zuvor dem Kurfürst von Köln und Herzog August von Braunschweig-Lüneburg erteilte kaiserliche Kommission und ohne die in allen Restitutionsbestimmungen vorgeschriebene vorhergehende Prüfung der Frage, ob die Angelegenheit überhaupt unter die Restitutionsregelungen des Friedensschlusses falle. Die Grafen argumentieren, die Jesuiten hätten die strittige Hälfte erst nach 1624 erlangt. 1624 seien sie, die Grafen, Eigentümer dieser Hälfte gewesen. Da der Friedensvertrag 1624 als Normaljahr für Restitutionen festgeschrieben habe, müsse ihnen die Hälfte zurückgegeben werden. Nachdem ihnen der Kurfürst von Köln als der in Restitutionsangelegenheiten zuständige ausschreibende Fürst des Westfälischen Kreises die erbetene Restitution versagt und somit die Justiz verweigert habe, hätten sie, die Grafen, sich an die benachbarten Fürsten des Niedersächsischen Kreises gewandt (Herzog von Braunschweig-Lüneburg, König von Schweden als Herzog von Bremen). Dieses Verfahren sei in den entsprechenden Friedensvereinbarungen so vorgesehen. Die Jesuiten erwidern, die Restitutionsbestimmungen des Friedensvertrags gelten nur für kriegsbedingte Besitzveränderungen kirchlicher Güter, nicht aber – wie im gegebenen Fall - für eine Besitzveränderung aufgrund eines gewöhnlichen Legats, welches eine “causa pure civilis” sei. Außerdem sei das Kloster schon vor 1596 säkularisiert worden, so dass es sich bei strittigen Gütern nicht um kirchliche, sondern um weltliche Güter handle. In der Folge ergehen zahlreiche Befehle zur Rückgabe der lippischen Hälfte an die Jesuiten, die konfessionell paritätisch besetzte Kommissionen durchsetzen sollen. Dieses scheitert an der Weigerung des jeweiligen |
| evangelischen Kommissars (des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg, des Grafen von Oldenburg, des Grafen von Bentheim-Tecklenburg, des Kurfürsten von Brandenburg bzw. des Königs in Preußen) eine zugunsten eines evangelischen Stands erfolgte Restitution rückgängig zu machen. Nachdem der Reichshofrat 1700 in einem ausführlichen Votum ad imperatorem der Argumentation der Jesuiten beipflichtet, werden die kreisaussc hreibenden Fürsten des Westfälischen Kreises erneut aufgefordert, die Jesuiten wieder in den Besitz der lippischen Hälfte der Klostergüter zu bringen. Der König in Preußen als einer dieser kreisausschreibenden Fürsten erwidert daraufhin, der Streit betreffe das ganze Corpus Evangelicum und müsse erst mit diesem besprochen werden. Die evangelischen Stände unterstützen mit zahlreichen Gesuchen die lippische Position. Da sich die Jesuiten bereits 1649 an die Reichsdeputation gewandt hätten, sei der Reichshofrat nicht das forum competens. Der Streit müsse von einer Reichsdeputation entschieden werden. Die Jesuiten bitten darum, die Restitution den beiden anderen ausschreibenden Fürsten des Westfälischen Kreises (Pfalzgraf und Bischof von Münster) aufzutragen. |
| Entscheidungen: | Befehl an Graf Simon VI. zur Lippe, den Kreuzherren den ihnen zustehenden Teil des Klosters einzuräumen oder Einwände vorzubringen, 1597 06 13 (Konz.), fol. 10rv; Kommissionsauftrag an Kurfürst Ferdinand von Köln, 1623 09 12 (Abschr.), fol. 26v-29v (u. a.); Votum ad imperatorem: Falls Graf Simon VII. nicht gehorche, soll der Kurfürst die Einsetzung der Jesuiten exekutorisch vornehmen, 1626 02 13, fol. 18rv; Urteil: Die Jesuiten sollen in den geerbten Teil des Klosters eingesetzt werden, der Graf oder die Kreuzherren dürfen ihre Einreden aber noch vortragen, 1626 02 17 (Abschr.), fol. 20r (u. a.); Erweiterung des Kommissionsauftrags an den Kurfürst von Köln um die Befugnis, das Urteil gegen den Grafen zu vollstrecken, 1626 03 22 (Abschr.), fol. 78v-80v; Befehl an die Grafen zur Lippe, vermeintliche Restitutionsansprüche nicht eigenmächtig durchzusetzen, sondern den Rechtsweg einzuschlagen und solange keine Übergriffe vorzunehmen, 1649 03 26 (Konz.), fol. 189r-191r; Kommissionsbefehl an den Kurfürst von Köln als Bischof von Münster und an Herzog August von Braunschweig-Lüneburg, 1649 03 26 (Konz.), fol. 192r-194r, ferner (Abschr.), fol. 334r-335r; Votum ad imperatorem, 1650 04 04, fol. 226r-231v, gebilligt im Geheimen Rat 1650 05 11, fol. 231v, in der Folge: Befehl an die kaiserlichen Gesandten in Nürnberg, die Deputierten an die Restitutionsbeschlüsse zu erinnern und sie zu ermahnen, die Sache nach eingehender Prüfung entweder selbst zu entscheiden oder der kaiserlichen Kommission ihren Lauf zu lassen, 1650 05 11 (Konz.), fol. 232r-233r; Kommissionsauftrag an den Bischof von Münster und den Graf von Oldenburg, 1652 01 16 (Konz.), fol. 252r-258r, ferner (Abschr.), fol. 322r-323r; Befehl an den Graf zur Lippe, während des anhängigen Streits in den zu Falkenhagen gehörenden Waldungen keine Bäume zu fällen, 1654 08 03 (Konz.), fol. 274rv, ferner (Abschr.), fol. 326rv; Befehl an Graf Hermann Adolf zur Lippe-Detmold, die Jesuiten in dem Besitz der ihnen seinerzeit vom Bischof von Paderborn übereigneten Hälfte nicht zu beeinträchtigen, 1661 06 13 (Konz.), fol. 291r-292v; dergl. Befehl an die ausschreibenden Fürsten des Niedersächsischen Kreises, die schwedische Krone sowie Herzog August von Braunschweig-Lüneburg, 1661 06 13 (Konz.), fol. 293r-294v; Kommissionsauftrag an den Bischof von Münster und Graf Johann Adolf von Bentheim-Tecklenburg, 1674 06 14 (Konz.), fol. 328r-329r; Kommissionsauftrag an die kreisausschreibenden Fürsten des Westfälischen Kreises, 1698 12 15 (Konz.), fol. 445rv, ferner (Abschr.), fol. 449rv; Votum ad imperatorem (ausführliche Erörterungen über die konfessionspolitischen Dimensionen des Streits, die Restitutionsbestimmungen, die Motive der Parteien, insbesondere der evangelischen Seite, etwa des Kurfürsten von Brandenburg), 1700 01 11, fol. 530r-552r; mit einer Ausnahme gebilligt im Geheimen Rat, 1700 08 25 und 1701 02 25, fol. 553v; Aufforderung an das westfälische Kreisausschreibamt, den Kommissionsauftrag von 1698 zu erfüllen, 1701 02 25 (Konz.), fol. 554rv, ferner (Abschr.), fol. 563r; dergl. Befehle an die kreisausschreibende Fürsten, den Pfalzgrafen bei Rhein, 1701 02 25 (Konz.), fol. 556r-557r, und den König in Preußen, 1701 02 28 (Konz.), fol. 558r, ferner (Abschr.), fol. 563v-564r; Ermahnung an Graf Friedrich Adolf zur Lippe-Detmold, sich nicht ferner zu widersetzen und gewahr zu sein, dass bei einer Exekution alle Kosten derselben auf ihn fallen werden, 1717 02 03 (Konz.), fol. 668r-669r. |
| Umfang: | Fol. 1-735 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=3287609 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |
|